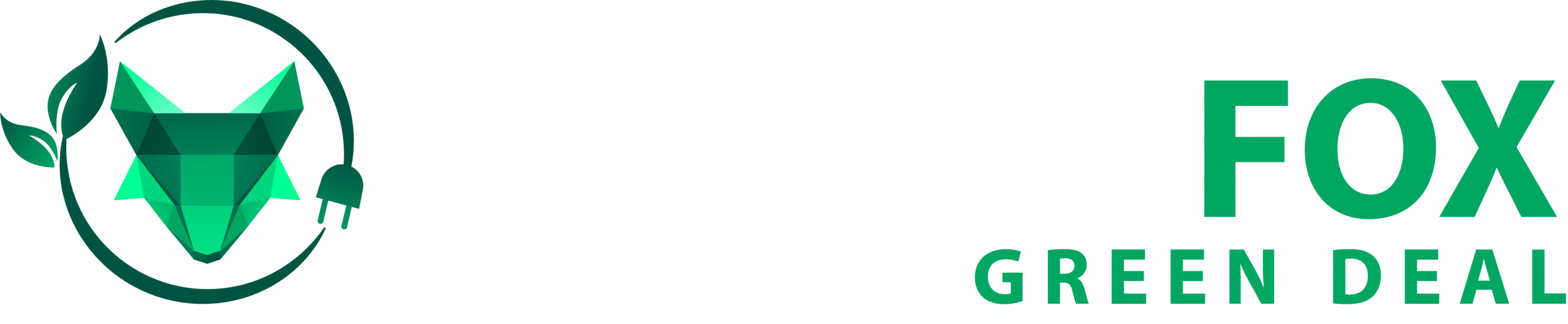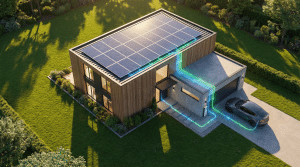Stell dir vor: Deine Solaranlage produziert mittags mehr Strom, als du verbrauchen kannst. Bisher hast du den Überschuss für magere 7,86 Cent pro Kilowattstunde ins Netz eingespeist. Ab Juni 2026 könntest du ihn stattdessen zu individuell vereinbarten Preisen direkt an deine Nachbarn verkaufen – durch Energy Sharing. Die zahlen möglicherweise trotzdem weniger als für normalen Netzstrom. Klingt nach einem Win-Win? Das ist die Vision von Energiegemeinschaften, die Deutschland ab 2026 ermöglicht.
Was ist Energy Sharing überhaupt?
Energy Sharing Definition: Energy Sharing ermöglicht es Privatpersonen und kleinen Unternehmen, selbst erzeugten Solarstrom virtuell mit anderen Teilnehmern in ihrer Region zu teilen. Die Energiegemeinschaft (Energy Sharing Community) nutzt das öffentliche Stromnetz, während Smart Meter die Zuordnung von Erzeugung und Verbrauch digital erfassen. Ab Juni 2026 ist Energy Sharing in Deutschland gesetzlich möglich.
Nicht physikalisch – der Strom fließt weiterhin den kürzesten Weg durchs Netz. Aber virtuell wird er dir und deinen Mitstreitern zugeordnet. Das Ganze läuft über eine sogenannte Energy Sharing Community (ESC), in der sich mehrere Haushalte oder Betriebe zusammenschließen.
Das Revolutionäre daran: Energy Sharing macht die Energiewende zum Gemeinschaftsprojekt. Du bist nicht mehr nur passiver Einspeiser, sondern aktiver Teil einer lokalen Energieversorgung. Und das Beste? Alle könnten davon profitieren – finanziell und ökologisch.
Warum Energy Sharing gerade jetzt so wichtig wird
Deutschland hat sich lange geziert. Während Österreich seit Juli 2021 erfolgreich Energy Sharing umsetzt und inzwischen über 3.000 Energiegemeinschaften mit rund 100.000 Zählpunkten (Stand: Anfang 2025) zählt, haben wir jahrelang diskutiert. Am 13. November 2025 hat der Bundestag endlich das entsprechende Gesetz beschlossen. Ab dem 1. Juni 2026 soll es offiziell losgehen.
Die Europäische Union fordert Energy Sharing schon seit 2018 in ihrer Erneuerbare-Energien-Richtlinie. Deutschland musste umsetzen – und hat es nun getan. Der neue § 42c im Energiewirtschaftsgesetz schafft die rechtliche Grundlage dafür, dass du deinen Solarstrom endlich sinnvoll mit anderen teilen kannst.
Wie funktioniert Energy Sharing technisch?
Keine Sorge, du musst kein Elektriker sein, um Energy Sharing zu verstehen. Das Prinzip ist simpel:
Die virtuelle Zuordnung
Deine Solaranlage produziert Strom. Dieser fließt physikalisch immer zum nächstgelegenen Verbraucher – egal ob der zu deiner Community gehört oder nicht. Die Zuordnung erfolgt rein virtuell über eine digitale Plattform.
Ein Beispiel: Du produzierst mittags 10 Kilowattstunden, verbrauchst selbst 3 Kilowattstunden. Die restlichen 7 Kilowattstunden werden deinen Community-Mitgliedern virtuell zugeordnet – je nachdem, wer gerade Strom braucht und wie ihr das untereinander geregelt habt.
Smart Meter machen’s möglich
Herzstück des Ganzen sind intelligente Messsysteme, auch Smart Meter genannt. Diese digitalen Stromzähler erfassen alle 15 Minuten, wie viel Strom du erzeugst oder verbrauchst. Die Daten werden verschlüsselt übertragen und von der Community-Plattform abgeglichen.
Hier liegt allerdings ein Problem: Der Smart-Meter-Rollout in Deutschland hinkt massiv hinterher. Im ersten Quartal 2025 waren etwa 15% der Haushalte, die ein Smart Meter haben müssten, tatsächlich damit ausgestattet. Die Gesamtquote über alle Haushalte liegt bei nur 2,8%. Ohne Smart Meter kein Energy Sharing – das ist gesetzlich vorgeschrieben.
Die gute Nachricht: Die Installation ist in vollem Gang, und bis 2026 sollten deutlich mehr Haushalte ausgestattet sein. Die Kosten für dich liegen bei 20-50 Euro pro Jahr – ein überschaubarer Betrag im Vergleich zu den möglichen Vorteilen.

Was könnte dir Energy Sharing bringen?
Jetzt wird’s interessant. Lass uns über Geld reden – und über mehr als das.
Für Anlagenbetreiber: Potenziell mehr Erlös für deinen Solarstrom
Aktuell bekommst du für neu installierte Anlagen (bis 10 kWp) eine Einspeisevergütung von 7,86 Cent pro Kilowattstunde (Stand: August 2025 bis Januar 2026). Mit Energy Sharing könnten je nach Community-Vereinbarung höhere Preise erzielt werden. Erste Erfahrungen aus Österreich und Schätzungen deuten auf mögliche Preise im Bereich von 15-30 Cent pro Kilowattstunde hin – abhängig von lokalen Strompreisen, Nachfrage und individuellen Vereinbarungen.
Beispielrechnung (ohne Gewähr): Deine 10-kWp-Anlage produziert 10.000 Kilowattstunden im Jahr. Davon verbrauchst du 4.000 selbst (spart dir bei angenommenen Netzbezugskosten von ca. 35 Cent pro Kilowattstunde = 1.400 Euro). Die restlichen 6.000 Kilowattstunden speist du bisher für 7,86 Cent ein = 472 Euro. Macht zusammen 1.872 Euro Ersparnis/Erlös.
Bei Energy Sharing könntest du die 6.000 Kilowattstunden beispielhaft zu 20 Cent verkaufen = 1.200 Euro (statt 472 Euro). Theoretischer Mehrerlös: 728 Euro pro Jahr.
Wichtig: Diese Rechnung berücksichtigt NICHT:
Verwaltungskosten der Community (geschätzt 100-200 € pro Jahr)
Smart Meter Kosten (20-50 € pro Jahr)
Plattformgebühren (variabel)
Steuerliche Aspekte
Transaktionskosten
Der tatsächliche Mehrerlös hängt stark von der konkreten Ausgestaltung deiner Community ab und kann erheblich von dieser Beispielrechnung abweichen.
Für Teilnehmer ohne Anlage: Möglicherweise günstigerer Ökostrom
Du hast keine eigene Solaranlage? Vielleicht wohnst du zur Miete, oder dein Dach eignet sich nicht? Informiere dich hier über unsere Photovoltaik-Anlagen und werde Teil der Energiewende. Doch selbst ohne eigene Anlage könnte Energy Sharing für dich interessant sein. Als Community-Mitglied beziehst du Strom direkt von den Anlagen in deiner Nachbarschaft – potenziell zu günstigeren Preisen als vom normalen Stromanbieter.
Beispielrechnung (ohne Gewähr): Ein durchschnittlicher Haushalt verbraucht 3.500 Kilowattstunden im Jahr. Bei durchschnittlichen Strompreisen von 30-40 Cent pro kWh (je nach Tarif, Stand: 2025) zahlst du zwischen 1.050 und 1.400 Euro pro Jahr.
In einer Energy Sharing Community könntest du beispielsweise 50% des Stroms zu einem vereinbarten Preis von 20 Cent aus der Community beziehen und 50% weiterhin zu 25 Cent als Reststrom von deinem Versorger. Mögliche Jahreskosten: ca. 788 Euro. Ersparnis gegenüber 35 Cent-Tarif: ca. 437 Euro (ca. 31%).
Je nachdem, wie viel Sharing-Strom verfügbar ist und wie die konkreten Preisvereinbarungen aussehen, können die Einsparungen höher oder niedriger ausfallen. Bei Haushalten mit Wärmepumpe und höherem Verbrauch könnte das Einsparpotenzial entsprechend größer sein.
Mehr als Geld: Die anderen Vorteile
Energy Sharing ist nicht nur gut für deinen Geldbeutel. Es könnte auch gut sein für:
Die Umwelt: Jede Kilowattstunde lokal genutzten Solarstrom spart gegenüber dem deutschen Strommix etwa 400-600 Gramm CO₂ (abhängig vom verdrängten Strommix). Bei 15.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch einer kleinen Community wären das etwa 6-9 Tonnen CO₂ – jedes Jahr.
Deine Unabhängigkeit: Du machst dich unabhängiger von großen Energiekonzernen und deren Preisschwankungen. Deine Community legt die Preise selbst fest.
Deine Nachbarschaft: Energy Sharing schweißt zusammen. Gemeinsame Projekte schaffen Verbundenheit. Plötzlich kennst du die Leute drei Straßen weiter – weil ihr zusammen eure Energieversorgung organisiert.
Energy Sharing in Norddeutschland: Deine Chancen
Du fragst dich vielleicht: „Funktioniert das bei uns im Norden überhaupt? Wir haben doch viel weniger Sonne als Bayern.“
Die Antwort: Ja, und zwar besonders gut! Hier ist warum:
1. Norddeutschland hat Windenergie: Energy Sharing funktioniert nicht nur mit Solar, sondern auch mit Windkraft. Die Kombination aus Solaranlagen im Sommer und Windenergie im Winter ergibt eine hervorragende Versorgungssicherheit.
2. Städte wie Hamburg sind ideal: Viele Mehrfamilienhäuser, hohe Strompreise, engagierte Bürger. Energy Sharing kann in städtischen Quartieren besonders effektiv sein.
3. Fortschrittliche Stadtwerke: Einige norddeutsche Stadtwerke sind Vorreiter bei erneuerbaren Energien. Sie könnten zu den ersten gehören, die Energy Sharing als Dienstleistung anbieten.
4. Starke Genossenschafts-Kultur: Gerade im Norden gibt es eine lange Tradition von Energiegenossenschaften. Diese Erfahrung ist Gold wert beim Aufbau von Energy Sharing Communities.
Ja, Bayern hat mehr Sonnenstunden. Aber Energy Sharing ist kein Wettbewerb. Es geht darum, die regional vorhandene Energie optimal zu nutzen. Und das funktioniert überall.
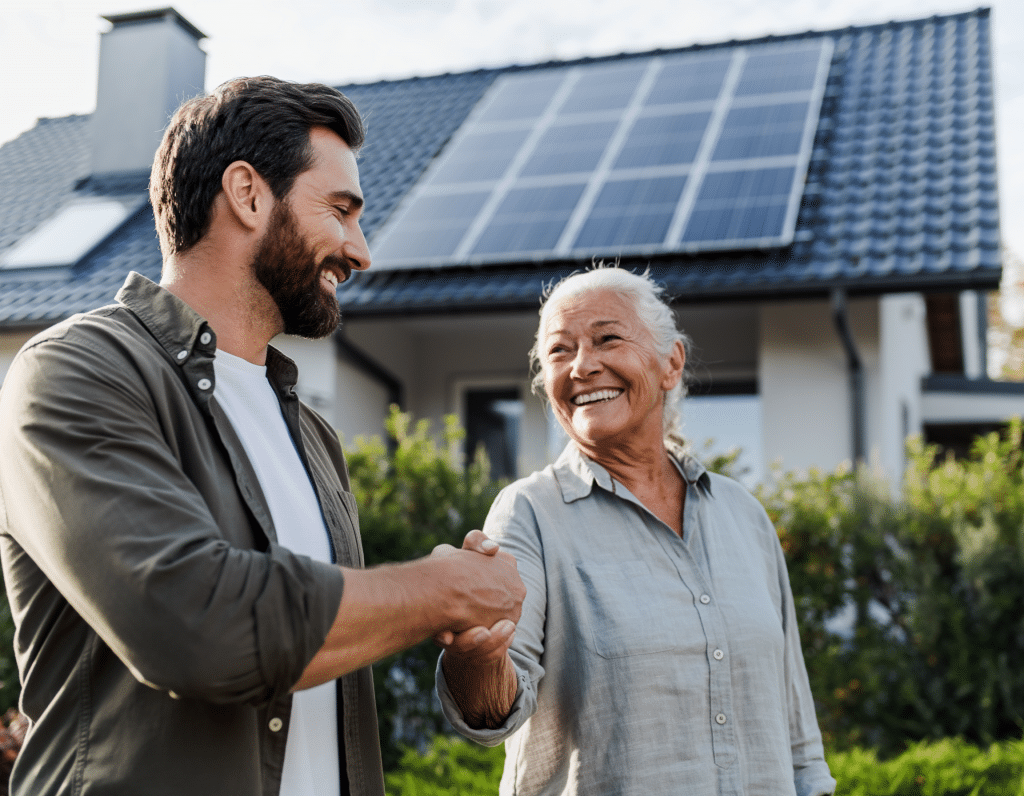
Wer kann bei Energy Sharing mitmachen?
Die gute Nachricht: Fast jeder! Der § 42c EnWG definiert, wer teilnehmen darf:
Privatpersonen (natürliche Personen)
Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) – also Betriebe mit weniger als 250 Mitarbeitern und unter 50 Millionen Euro Jahresumsatz
Öffentliche Einrichtungen wie Gemeinden
Bürgerenergiegesellschaften wie Genossenschaften
Große Energiekonzerne sind explizit ausgeschlossen. Das soll verhindern, dass finanzstarke Player das Modell dominieren. Energy Sharing bleibt bürgergetrieben.
Räumliche Begrenzung (vorerst)
Es gibt eine Einschränkung: Bis zum 1. Juni 2028 ist Energy Sharing nur innerhalb eines Verteilnetzgebiets möglich. Das ist typischerweise das Versorgungsgebiet deines lokalen Stadtwerks.
In der Praxis bedeutet das: Du kannst mit Nachbarn in deiner Stadt oder Gemeinde eine Community bilden, aber nicht mit deiner Tante in Hamburg, wenn du in Lübeck wohnst. Ab 2028 sollen auch angrenzende Netzgebiete möglich werden – dann wird’s noch flexibler.
Die ersten Schritte zur eigenen Energy Sharing Community
Du bist überzeugt und willst loslegen? Super! Hier ist ein grober Fahrplan:
1. Informiere dich weiter: Dieser Artikel ist ein Anfang. Du brauchst noch mehr Details zu Rechtlichem, Technischem und Organisatorischem. (Tipp: Wir veröffentlichen in den nächsten Monaten weitere Artikel zu allen wichtigen Aspekten – bleib dran!)
2. Finde Mitstreiter: Sprich mit Nachbarn, die auch Solaranlagen haben. Oder mit Leuten, die gerne günstigen Ökostrom beziehen würden. Eine Energy Sharing Community macht ab etwa 5-10 Teilnehmern richtig Sinn.
3. Wähle eine Rechtsform: Für größere Gruppen eignet sich die eingetragene Genossenschaft am besten. Sie ist demokratisch organisiert, die Haftung ist beschränkt, und es gibt etablierte Prüfverbände, die dich unterstützen.
4. Kümmere dich um die Technik: Alle Teilnehmer brauchen Smart Meter. Zudem benötigt die Community eine digitale Plattform für die Abrechnung. Es gibt bereits Anbieter, die solche Lösungen entwickeln.
5. Hole dir Unterstützung: Die Gründung ist komplex. Du brauchst juristische Beratung, technisches Know-how und organisatorische Struktur. Das klingt nach viel – aber du musst es nicht alleine stemmen.
Energy Sharing vs. andere Modelle
Vielleicht hast du schon von Mieterstrom oder gemeinschaftlicher Gebäudeversorgung gehört. Wo liegt der Unterschied?
Mieterstrom: Funktioniert nur innerhalb eines Gebäudes, ohne Nutzung des öffentlichen Netzes. Vorteil: Du bekommst einen Mieterstromzuschlag vom Staat und musst reduzierte Netzentgelte zahlen. Nachteil: Räumlich sehr begrenzt.
Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (GGV): Auch nur innerhalb eines Gebäudes, aber ohne Mieterstromzuschlag. Seit Mai 2024 gesetzlich geregelt. Vorteil: Einfacher als Mieterstrom. Nachteil: Trotzdem nur ein Gebäude.
Energy Sharing: Nutzt das öffentliche Netz, funktioniert über ein ganzes Stadtgebiet. Vorteil: Viel größere räumliche Flexibilität, besserer Ausgleich zwischen Erzeugung und Verbrauch. Nachteil: Aktuell keine staatliche Förderung, du zahlst volle Netzentgelte.
Welches Modell für dich passt, hängt von deiner Situation ab. Energy Sharing ist besonders interessant, wenn du mit mehreren Parteien über verschiedene Gebäude hinweg zusammenarbeiten willst.
Die Herausforderungen: Nicht alles ist perfekt
Wir wollen ehrlich sein: Energy Sharing ist keine Wunderlösung. Es gibt Hürden.
Der bürokratische Aufwand ist nicht ohne. Eine Genossenschaft zu gründen dauert 3-6 Monate und kostet typischerweise 1.500-3.000 Euro. Laufend fallen 5-10 Stunden monatlicher Verwaltungsaufwand an. Das ist machbar, aber es braucht engagierte Menschen.
Die fehlende Förderung ist ein echtes Problem. Anders als in Österreich, wo Energiegemeinschaften bis zu 64% Netzentgelt-Reduzierung erhalten können, oder in Italien, wo der Staat Prämien zahlt, gibt es in Deutschland aktuell keine finanzielle Unterstützung über die reine Preisdifferenz hinaus. Das macht Energy Sharing weniger attraktiv als es sein könnte.
Der Smart-Meter-Rollout lahmt, wie erwähnt. Bis Juni 2026 sollte sich das gebessert haben, aber es bleibt ein Unsicherheitsfaktor.
Die Komplexität schreckt ab. Viele Menschen wissen gar nicht, was Energy Sharing ist. Selbst Akademiker haben oft große Informationsdefizite. Das wird sich ändern, aber es braucht Zeit und Aufklärung.
Trotz dieser Herausforderungen: Die Vorteile könnten überwiegen. Mit der richtigen Unterstützung ist Energy Sharing für viele Haushalte und Betriebe eine echte Chance.
Was noch kommen könnte
Die aktuelle Gesetzgebung ist ein Anfang, aber nicht das Ende. Es gibt Forderungen von Verbänden wie dem Bündnis Bürgerenergie nach:
Energy-Sharing-Prämien von 2-5 Cent pro Kilowattstunde
Reduzierten Netzentgelten wie in Österreich
Vereinfachten Verwaltungsverfahren
Förderung für einkommensschwache Haushalte, damit Energy Sharing nicht nur ein Modell für Besserverdiener bleibt
Ob und wann diese Forderungen umgesetzt werden, ist offen. Die neue Bundesregierung hat Energy Sharing im Koalitionsvertrag nicht explizit erwähnt – es könnte also noch holprig werden. Aber die EU-Verpflichtung besteht, und der gesellschaftliche Druck wächst.
Fazit: Jetzt informieren, 2026 durchstarten
Energy Sharing soll ab Juni 2026 Realität in Deutschland werden. Die gesetzlichen Grundlagen stehen. Die Technik funktioniert (in Österreich bewiesen mit über 3.000 Communities). Die potenziellen finanziellen Vorteile sind erheblich. Die ökologische Wirkung könnte positiv sein. Und der soziale Zusammenhalt in Nachbarschaften wird gestärkt.
Ist es perfekt? Nein. Die fehlende Förderung ist ein Problem. Der bürokratische Aufwand ist hoch. Der Smart-Meter-Rollout hinkt hinterher.
Ist es trotzdem eine Chance? Möglicherweise. Für dich als Anlagenbetreiber könnte Energy Sharing deutlich mehr Erlös aus deiner Solaranlage bedeuten. Für dich als Verbraucher könnte es günstigeren Ökostrom und aktive Teilhabe an der Energiewende bedeuten. Für uns alle könnte es mehr Unabhängigkeit, mehr lokale Wertschöpfung und weniger CO₂ bedeuten.
Die nächsten Monate sind entscheidend. Wer sich jetzt informiert, wer jetzt Netzwerke aufbaut, wer jetzt die Weichen stellt, kann 2026 von Anfang an dabei sein. Energy Sharing wird kein Massengeschäft über Nacht – aber es hat das Potenzial, in den nächsten Jahren viele Haushalte und Unternehmen zu erreichen.
Bist du bereit, Teil dieser Bewegung zu werden?
Häufig gestellte Fragen zu Energy Sharing
Was kostet die Teilnahme an Energy Sharing?
Die Kosten setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen: Smart Meter (20-50 € pro Jahr), Verwaltungskosten der Community (geschätzt 100-300 € pro Jahr) und gegebenenfalls Plattformgebühren. Bei der Gründung einer Energiegenossenschaft fallen einmalig 1.500-3.000 € an. Die tatsächlichen Kosten hängen stark von der Größe und Organisation deiner Community ab.
Wann startet Energy Sharing in Deutschland offiziell?
Energy Sharing startet offiziell am 1. Juni 2026. Am 13. November 2025 wurde das entsprechende Gesetz (§ 42c EnWG) vom Bundestag beschlossen. Bis zum Start sollten die technischen und organisatorischen Voraussetzungen geschaffen werden.
Brauche ich zwingend einen Smart Meter für Energy Sharing?
Ja, ein intelligentes Messsystem (Smart Meter) ist gesetzlich vorgeschrieben. Nur so kann die viertelstündliche Erfassung und virtuelle Zuordnung von Erzeugung und Verbrauch erfolgen. Der Smart-Meter-Rollout läuft, aber aktuell (Stand 2025) sind erst etwa 2,8% aller Haushalte ausgestattet.
Kann ich Energy Sharing auch als Mieter nutzen?
Ja! Du brauchst keine eigene Solaranlage, um bei Energy Sharing mitzumachen. Als Verbraucher-Mitglied einer Energy Sharing Community beziehst du den gemeinsam erzeugten Strom potenziell günstiger als von deinem regulären Stromanbieter. Du profitierst vom Solarstrom deiner Nachbarn.
Funktioniert Energy Sharing auch mit Windkraft?
Ja, Energy Sharing ist technologieneutral. Es funktioniert mit Photovoltaik, Windkraft, Wasserkraft und anderen erneuerbaren Energien. Besonders in Norddeutschland könnte die Kombination aus Solaranlagen und Windkraft eine sehr stabile Versorgung ermöglichen.
Wie weit kann ich meinen Strom mit Energy Sharing teilen?
Bis zum 1. Juni 2028 ist Energy Sharing auf ein Verteilnetzgebiet beschränkt – das ist typischerweise das Versorgungsgebiet deines lokalen Stadtwerks. Du kannst also mit Nachbarn in deiner Stadt oder Gemeinde teilen, aber nicht deutschlandweit. Ab 2028 sollen auch angrenzende Netzgebiete möglich werden.
Lohnt sich Energy Sharing auch für kleine Solaranlagen?
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab: Größe der Community, vereinbarte Preise, dein Eigenverbrauch und die laufenden Kosten. Generell gilt: Je mehr Überschussstrom du hast und je besser die Community-Preise sind, desto attraktiver wird Energy Sharing. Bei sehr kleinen Anlagen mit hohem Eigenverbrauch könnte der Mehraufwand die Vorteile überwiegen.
Was passiert mit meiner Einspeisevergütung bei Energy Sharing?
Du kannst selbst entscheiden: Entweder du verkaufst deinen Überschussstrom über Energy Sharing zu frei vereinbarten Preisen, oder du behältst die klassische Einspeisevergütung (aktuell 7,86 Cent/kWh für Anlagen bis 10 kWp). Beides parallel für denselben Strom geht nicht. Energy Sharing lohnt sich vor allem dann, wenn du deutlich mehr als die Einspeisevergütung erzielen kannst.
Welche Rechtsform eignet sich am besten für eine Energy Sharing Community?
Für größere Gruppen ab etwa 10 Mitgliedern hat sich die eingetragene Genossenschaft (eG) bewährt. Sie ist demokratisch organisiert (ein Mitglied, eine Stimme), die Haftung ist beschränkt, und es gibt etablierte Prüfverbände zur Unterstützung. Für kleinere Gruppen kommen auch Vereine oder GbRs in Frage, die sind aber rechtlich komplexer bei der Energieabrechnung.
Lass dich von uns beraten – kostenlos und unverbindlich
Energy Sharing klingt spannend für dich, aber du hast noch Fragen? Das ist völlig normal. Die Materie ist komplex, und jede Situation ist anders.
Bei Future Fox beschäftigen wir uns seit Monaten intensiv mit Energy Sharing. Wir haben ein Netzwerk von Partnern für rechtliche Ausgestaltung, technische Umsetzung und organisatorische Begleitung. Und wir kennen den norddeutschen Markt wie unsere Westentasche.
Wir bieten dir ein kostenloses, unverbindliches Beratungsgespräch an. Dabei schauen wir uns gemeinsam an:
✓ Ist deine Photovoltaikanlage für Energy Sharing geeignet?
✓ Welche Einsparpotenziale könntest du haben?
✓ Wie könntest du eine Community in deiner Region aufbauen?
✓ Welche technischen Voraussetzungen musst du schaffen?
✓ Mit welchen Kosten und welchem Aufwand musst du rechnen?
Jetzt kostenloses Beratungsgespräch vereinbaren →
Alternativ kannst du uns auch einfach anrufen unter +49160 903 321 182 oder eine E-Mail schreiben an sven@futurefox.eu. Wir freuen uns darauf, mit dir die Möglichkeiten von Energy Sharing zu besprechen!
Über Future Fox: Wir sind dein regionaler Partner für erneuerbare Energien in Norddeutschland. Mit zahlreichen Photovoltaik-Projekten haben wir bewiesen, dass nachhaltige Energieversorgung praktisch, wirtschaftlich und zukunftssicher ist. Jetzt begleiten wir dich auch beim Thema Energy Sharing – von der ersten Information bis zur fertigen Community.
Unsere Photovoltaik-Referenzprojekte ansehen →
Rechtliche Hinweise & Haftungsausschluss
Gesetzesstand und Aktualität
Dieser Artikel basiert auf dem Gesetzgebungsstand vom 13. November 2025. Das Energy Sharing Gesetz (§ 42c EnWG) wurde am 13. November 2025 vom Bundestag beschlossen. Das geplante Inkrafttreten ist der 1. Juni 2026. Gesetzliche Regelungen, Termine und Rahmenbedingungen können sich ändern.
Beispielrechnungen und Preisangaben
Alle in diesem Artikel genannten Beispielrechnungen, Preisangaben, Erlöse und Einsparungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung und stellen keine Garantie für tatsächlich erzielbare Ergebnisse dar. Die verwendeten Preise (z.B. 20-25 Cent/kWh für Energy Sharing) sind Schätzwerte basierend auf Erfahrungen aus anderen Ländern und theoretischen Überlegungen.
Tatsächliche Erlöse und Kosten können erheblich abweichen und hängen ab von:
Individuellen Community-Vereinbarungen
Lokalen Strompreisen und Marktentwicklungen
Regionalen Netzentgelten
Verfügbarkeit und Nachfrage innerhalb der Community
Verwaltungs- und Betriebskosten
Steuerlichen Aspekten
Technischen Gegebenheiten
Kostenhinweis
Die Beispielrechnungen berücksichtigen teilweise nicht alle anfallenden Kosten wie:
Verwaltungskosten der Community (geschätzt 100-300 €/Jahr)
Smart Meter Kosten (20-50 €/Jahr)
Plattform- und Transaktionsgebühren
Steuerliche Belastungen
Gründungs- und Beratungskosten
Laufende Betriebskosten
Keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung
Dieser Artikel stellt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar. Jede Energy Sharing Community ist individuell, und die konkreten Bedingungen können erheblich von den hier dargestellten Beispielen abweichen.
Wir empfehlen vor der Gründung einer Community dringend die Einholung fachkundiger Beratung durch:
Rechtsanwälte (Energierecht, Genossenschaftsrecht)
Steuerberater (Einkommensteuer, Umsatzsteuer)
Energieberater
Wirtschaftsprüfer oder Finanzexperten
Haftungsausschluss
Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen. Die Nutzung der Informationen erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Nutzung dieser Informationen entstehen, wird ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
Quellen und Referenzen
Die verwendeten Informationen basieren unter anderem auf:
Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts (13.11.2025)
Bundesnetzagentur (Einspeisevergütungssätze, Smart Meter Statistiken)
Erfahrungen aus Österreich (Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften)
Verschiedene Fachpublikationen und Studien
Stand der Informationen: November 2025
Lass dich von uns beraten – kostenlos und unverbindlich
Energy Sharing klingt spannend für dich, aber du hast noch Fragen? Das ist völlig normal. Die Materie ist komplex, und jede Situation ist anders.
Bei Future Fox beschäftigen wir uns seit Monaten intensiv mit Energy Sharing. Wir haben ein Netzwerk von Partnern für rechtliche Ausgestaltung, technische Umsetzung und organisatorische Begleitung. Und wir kennen den norddeutschen Markt wie unsere Westentasche.
Wir bieten dir ein kostenloses, unverbindliches Beratungsgespräch an. Dabei schauen wir uns gemeinsam an:
✓ Ist deine Photovoltaikanlage für Energy Sharing geeignet?
✓ Welche Einsparpotenziale könntest du haben?
✓ Wie könntest du eine Community in deiner Region aufbauen?
✓ Welche technischen Voraussetzungen musst du schaffen?
✓ Mit welchen Kosten und welchem Aufwand musst du rechnen?
Jetzt kostenloses Beratungsgespräch vereinbaren →
Alternativ kannst du uns auch einfach anrufen unter +49 160 903 211 82 oder eine E-Mail schreiben an sven@futurefox.eu . Wir freuen uns darauf, mit dir die Möglichkeiten von Energy Sharing zu besprechen!
Über Future Fox: Wir sind dein regionaler Partner für erneuerbare Energien in Norddeutschland. Mit zahlreichen Photovoltaik-Projekten haben wir bewiesen, dass nachhaltige Energieversorgung praktisch, wirtschaftlich und zukunftssicher ist. Jetzt begleiten wir dich auch beim Thema Energy Sharing – von der ersten Information bis zur fertigen Community.
Rechtliche Hinweise & Haftungsausschluss
Gesetzesstand und Aktualität
Dieser Artikel basiert auf dem Gesetzgebungsstand vom 13. November 2025. Das Energy Sharing Gesetz (§ 42c EnWG) wurde am 13. November 2025 vom Bundestag beschlossen. Das geplante Inkrafttreten ist der 1. Juni 2026. Gesetzliche Regelungen, Termine und Rahmenbedingungen können sich ändern.
Beispielrechnungen und Preisangaben
Alle in diesem Artikel genannten Beispielrechnungen, Preisangaben, Erlöse und Einsparungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung und stellen keine Garantie für tatsächlich erzielbare Ergebnisse dar. Die verwendeten Preise (z.B. 20-25 Cent/kWh für Energy Sharing) sind Schätzwerte basierend auf Erfahrungen aus anderen Ländern und theoretischen Überlegungen.
Tatsächliche Erlöse und Kosten können erheblich abweichen und hängen ab von:
Individuellen Community-Vereinbarungen
Lokalen Strompreisen und Marktentwicklungen
Regionalen Netzentgelten
Verfügbarkeit und Nachfrage innerhalb der Community
Verwaltungs- und Betriebskosten
Steuerlichen Aspekten
Technischen Gegebenheiten
Kostenhinweis
Die Beispielrechnungen berücksichtigen teilweise nicht alle anfallenden Kosten wie:
Verwaltungskosten der Community (geschätzt 100-300 €/Jahr)
Smart Meter Kosten (20-50 €/Jahr)
Plattform- und Transaktionsgebühren
Steuerliche Belastungen
Gründungs- und Beratungskosten
Laufende Betriebskosten
Keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung
Dieser Artikel stellt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar. Jede Energy Sharing Community ist individuell, und die konkreten Bedingungen können erheblich von den hier dargestellten Beispielen abweichen.
Wir empfehlen vor der Gründung einer Community dringend die Einholung fachkundiger Beratung durch:
Rechtsanwälte (Energierecht, Genossenschaftsrecht)
Steuerberater (Einkommensteuer, Umsatzsteuer)
Energieberater
Wirtschaftsprüfer oder Finanzexperten
Haftungsausschluss
Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen. Die Nutzung der Informationen erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Nutzung dieser Informationen entstehen, wird ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
Quellen und Referenzen
Die verwendeten Informationen basieren unter anderem auf:
Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts (13.11.2025)
Bundesnetzagentur (Einspeisevergütungssätze, Smart Meter Statistiken)
Erfahrungen aus Österreich (Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften)
Verschiedene Fachpublikationen und Studien
Stand der Informationen: November 2025